C1) Mai 2020: "Luftlinien"-Wandertouren - Planung und Navigation
Im Menüpunkt
Planung
bin ich ausführlich auf die bisher in meinem Sprachgebrauch bekannten
Arten von Wandertouren eingegangen:
1) Wandertouren auf markierten Wanderwegen und
2) freigeplante Wandertouren
Wenn ich auf diesen zwei Arten von Wandertouren unterwegs bin, besitze
ich als Ergebnis der Planung immer sehr ausführliche Tracks, die
ich dann mit meinem Navigationsgerät "ablaufe".
Für markierte Wanderwege bräuchte ich keine Tracks, da gut
markierte Wanderwege für eine Wegfindung vollkommen ausreichen. Trotzdem
benutze ich auch für markierte Wanderwege immer Tracks, weil es, so
meine bisherige Erfahrung, immer wieder Situationen gibt, wo die
Markierungen fehlen (zB in Ortschaften) und damit eine Wegfindung sehr
schwierig wird.
Die Wandertouren aus meinem Wanderprojekt
Spanische Jakobswege
bestehen ausschließlich aus markierten Wanderwegen.
Bei der Planung von freigeplanten Wandertouren gebe ich für die
einzelnen Tagesetappen nur den Start- und Zielpunkt an. Diese beiden
Routenpunkte verbinde ich dann mit einer geraden Linie, der
Luftlinie. Meine Routenplanungssoftware bestimmt dann nach
Wander-Routenkriterien einen möglichen Wanderweg zwischen dem Start- und
Zielpunkt. Dabei ist es völlig egal, wo die Routenplanungssoftware den
Wanderweg entlangführt. Maßgebend sind nur der Start- und Zielpunkt.
Anschließend überprüfe ich den so berechneten Wanderweg für jede einzelne
Tagesetappe. Dabei vergleiche ich die berechnete Tagesetappe mit der
Luftlinie. Weicht der berechnete Wanderweg zu weit von der Luftlinie ab
oder der Wanderweg gefällt mir nicht so richtig (Abgleich mit Google
Maps), dann korrigiere ich den berechneten Wanderweg evtl. manuell. Das
ist ein sehr aufwändiges Verfahren zur Bestimmung von Tracks, die meinen
Anforderungen genügen.
Die Wandertouren aus meinem Wanderprojekt
Deutsche Langstreckenwanderungen
bestehen ausschließlich aus freigeplanten Wandertouren.
Mich hat es schon immer gereizt auf Langstreckenwanderungen frei durch
die Landschaft zu laufen, möglichst ohne jegliche Hilfsmittel. Landkarten
sind für mich zu umständlich und für Langstreckenwanderungen zu
teuer.
Aktuell navigiere ich mit meinem Handy und der App
Topo GPS. Das funktioniert prima.
Aber der Vorbereitungsaufwand für meine Tracks, die ich
immer brauche, ist immens hoch.
Was könnte ich tun?
Deshalb machte ich mir Gedanken, wie ich den Vorbereitungsaufwand
weiter minimieren könnte.
Bei meinen Wandertouren finde ich unendlich viel Zeit über bestimmte
Probleme nachzudenken.
Auf einer meiner letzten Trainingstouren in meiner Wohngegend ist mir die
Idee für eine neue Art von Wandertouren durch den Kopf geschossen. Nachdem
ich diese Idee im Kopf hin- und herwälzte, war der Name für diese Art von
Wandertouren geboren:
Luftlinien-Wandertouren
Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Für diese Art von Wandertouren gibt es keine "richtigen" Tracks (mehrere
hundert Trackpunkte pro Track und Tagesetappe), wie ich sie bei den
anderen zwei Arten von Wandertouren bestimmte. Bei dieser neuen Art von
Wandertouren verwende ich nur den Start- und Zielpunkt. Beide Punkte
verbinde ich mit einer geraden Linie, der Luftlinie. Daher auch der
Name für diese Art von Wandertouren. Das ist alles. Mehr gibt es nicht.
Meine Planungssoftware muß keinen Wanderweg zwischen dem Start- und
Zielpunkt berechnen. Ich muss nicht nachträglich überprüfen, wo die Tracks
entlangführen.
Wenn man es genau nimmt, ist diese Luftlinie ebenfalls ein Track. Dieser
Track ist aber der einfachste Track, den es überhaupt gibt. Er besteht nur
aus zwei Trackpunkten, dem Start- und Zielpunkt und verläuft mitten durch
die Landschaft und überhaupt nicht auf Wanderwegen.
Wie will ich mit diesen Luftlinien-Tracks navigieren?
Dafür lasse ich mir den Luftlinien-Track für die aktuelle Tagesetappe auf
dem Handy anzeigen. Dann versuche ich Wege zu finden, auf denen ich mich
immer in der Nähe der Luftlinie zum Tagesziel bewegen kann. Es gibt keinen
vorgeschriebenen Weg. Einziger Anhaltspunkt für die Navigation ist die
Luftlinie vom Start- zum Zielpunkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich
bei der Navigation auf Luftlinien-Wandertouren öfters auf das Handy
schauen muss als bei den anderen beiden Arten von Wandertouren.
Als Bezeichnung für diese Art von Wandertouren, den
Luftlinien-Wandertouren, werde ich statt
WTnnn ...
das Kürzel
WLnnn ...
verwenden.
Für erste Tests dieser Art von Wandertouren muss ich mir ein vertrautes
Gelände aussuchen, was ich ziemlich genau kenne. Nur so kann ich
überprüfen, ob diese neue Art von Wandertouren einigermaßen praktikabel
ist oder ob ich diese Idee als ein Hirngespinst abtun muss.
Da bietet sich der Harz an.
Eine denkbare erste Testroute wären die Luftlinien
1) von Schochwitz (mein Heimatort) nach
Goslar und dann anschließend
2) von Goslar nach Seesen und
abschließend
3) von Seesen nach
Schochwitz zurück.
Alle drei Teilabschnitte bin ich schon mit
freigeplanten Wandertouren gewandert. Ausführliche Tracks sind also
vorhanden, auf die ich im Notfall, wenn das Konzept nicht realisierbar
ist, zurückgreifen könnte.
Ein anderer Gedanke ist, ob ich die zurückgelegten Tagesetappen von
meinem Handy aufzeichnen lasse. Nur so erhalte ich genaue Informationen
über den tatsächlich zurückgelegten Weg. Da tut sich aber gleich ein
anderes Problem auf. Wenn ich mein Handy tagsüber im Aufzeichnungsmodus
laufen lasse, wird der Stromverbrauch entsprechend hoch sein.
Das muss ich alles testen.
Sollte sich diese Idee als tragbar erweisen, werde ich später die
Luftlinien-Wandertouren in den Menüpunkt
Planung
übernehmen.
Ich werde zu gegebener Zeit berichten, was aus dieser Idee geworden
ist.
C2) Oktober 2020: Garmin- oder OSM-Karten - Die Gretchenfrage
Mein erstes Navigationsgerät (ca. 2013) war ein
Garmin GPSmap 64st. Für die Planung von Wandertouren
verwendete ich daher am Anfang auch Garmin-Karten.
Meine erste Garmin-Karte war eine Karte von Deutschland. Die
Karte hat etwas über 100 Euro gekostet. Das ist schon ein
stolzer Preis für die Karte eines einzigen Landes. Der Preis
für alle Karten von Norwegen lag zu dieser Zeit
bei über 1000 Euro.
Einige Zeit später interessierte ich mich auch für
OSM-Karten. Auf meinem Garmin-Navi hatte ich seither
immer beide Kartenarten installiert.
Bei mit Garmin-Karten geplanten Wandertouren im Harz stellte ich vermehrt
fest, das geplante Wege nicht mehr vorhanden bzw. überhaupt nicht mehr
begehbar waren. Wenn ich das mit der OSM-Karte verglich, konnte ich
feststellen, dass die OSM-Karte die Wege nicht hatte, was ja richtig
war.
Zuerst wunderte ich mich, aber immer häufiger traten diese Probleme
auf.
Was konnte ich tun?
Vermehrt plante ich daher Wandertouren mit OSM-Karten. Die zuvor
genannten Probleme verringerten sich erheblich, sind aber nicht gänzlich
verschwunden. Auch bei der Nutzung von OSM-Karten gibt es Wege, die nicht
mehr vorhanden sind. Aber diese Fälle treten bei weitem nicht so häufig
auf, wie bei den Garmin-Karten.
Trifft man auf ein solches Problem, muss man nach einer Umgehung suchen.
Am Anfang machten mich diese Probleme nervös, aber mittlerweile lernte ich
damit umzugehen.
Aktuell plane ich meine Wandertouren nur noch mit OSM-Karten. Die
Garmin-Karten sind einfach zu teuer.
Der Aktualisierungs-Zyklus von Garmin-Karten dauert auch viel länger
als gegenüber den OSM-Karten. Bei OSM-Karten gibt es eine große Anzahl
von aktiven Nutzern, die die Karten durch ihre Mithilfe ständig
verbessern.
Einzig für die Planung einer Wandertour durch Schweden griff ich wieder
auf eine Garmin-Karte zurück. Das tat ich, weil die OSM-Karte für
bestimmte einsame Gebiete in Schweden überhaupt keine Wege ausgewiesen
hat. Um überhaupt eine Wandertour planen zu können, brauchte ich aber
Wege, egal ob sie vorhanden sind oder nicht.
Auf meinem Navi, was inzwischen ein Handy ist, sind in meiner bevorzugten
Navi-App Topo GPS nur OSM-Karten vorinstalliert. Wenn ich dann mit
Garmin-Karten geplante Tracks (zB für Schweden) auf dem Handy mit
OSM-Karten anzeigen lasse, sind dort manchmal für einsame Gebiete keine
Wege zu sehen. Der Track verläuft dann einfach durch die Landschaft. Ich
hoffe, dass dann in der Realität an solchen Stellen tatsächlich Wege sind,
die einigermaßen begehbar sind.
Wenn ich das Schweden-Projekt irgendwann realisieren sollte, wird sich
zeigen, welche Karten (Garmin oder OSM) verlässlich sind.
Nachtrag (Januar 2021): Auch mit OSM-Karten gibt es gelegentlich Probleme. Einmal sind das
falsche Wege, dann sind es sogar fehlende Wege. Für einen
Wanderer, der auf korrekte Wegeverläufe angewiesen ist, sind diese
Probleme nicht akzeptabel. In meiner Wohngegend, wo ich jeden Trampelpfad
kenne, fällt mir das bei Tagestouren immer wieder auf.
Deshalb betätige ich mich seit Januar 2021 als
OSM-Mapper.
Was macht ein OSM-Mapper?
Über eine
OSM-Plattform
-
korrigiere ich fehlerhafte Wegeverläufe und
-
füge fehlende Wegeverläufe hinzu.
Bei dieser Tätigkeit beschränke ich mich ausschließlich auf meine
Heimatregion, wo ich mich sehr gut auskenne.
In einem sehr ausführlichen Einführungsvideo wird genau erklärt, wie
diese Veränderungen im OSM-Datenbestand durchgeführt werden können.
C3) März 2021: Wanderkarten - Wie kann ich
Wanderkarten im A4-Format drucken?
Am Anfang meiner Wanderkarriere benutzte ich als Ersatznavigation die
eine oder andere Wanderkarte im Papierformat. Aber bei
Langstreckenwanderungen kann das sehr schnell ins Geld gehen, wenn Karten
mit geeigneten Maßstäben (zB 1:25000 oder 1:50000) verwendet werden sollen.
Deshalb bin ich schnell von den Wanderkarten weggekommen und verlasse mich
seit einigen Jahren auf die Technik.
Aber Technik kann versagen, was jeder sicherlich schon einmal erlebt
hat.
Wanderkarten aus Papier sind aber unzerstörbar.
Deshalb experimentierte ich in der Vergangenheit immer mal wieder mit
gedruckten Wanderkarten. Aber ich konnte keine geeignete Software und
kein geeignetes Verfahren ausfindig machen, das mir erlauben würde,
gedruckte Wanderkarten
-
einfach,
-
in einer optimalen Auflösung und
-
möglichst platzsparend (Vorder- und Rückseite)
zu erstellen.
Im
UL-Forum
(Ultraleicht-Trekking-Forum) hat ein User eine Lösung vorgeschlagen,
die meine Wünsche und Forderungen an eine praktikable Lösung
fast vollständig erfüllen.
Für die Erstellung von gedruckten Wanderkarten gibt es von dem
Forums-User ein sehr schönes
youtube-Video. Das Video beschreibt sehr genau die Vorgehensweise. Deshalb verweise ich
auf dieses Video und spare mir die Beschreibung.
Für die Auswahl der zu druckenden Landkartenbereiche kann man sich die
eigenen Tracks in das Programm laden und in der Karte anzeigen
lassen.
Einziges Manko des beschriebenen Verfahrens ist der Umstand, dass die
geladenen Tracks nicht in den gedruckten Wanderkarten dargestellt
werden können.
Das ist sehr bedauerlich.
Aber sonst liefert die Lösung optimale gedruckte Wanderkarten.
Als Workarround für die fehlenden eigenen Tracks, kann man die Tracks mit
einem farbigen Stift in die gedruckten Wanderkarten einzeichnen. Das ist
sicherlich ohne großen Aufwand möglich.
Vielleicht gibt es irgendwann eine Lösung für die Darstellung der eigenen
Tracks in den gedruckten Wanderkarten...
C4) Oktober 2021: Tracks aus dem Internet -
Fluch oder Segen?
Im Menüpunkt
Planung, in der 2.Phase (Feinplanung), bin ich schon einmal auf den Begriff
Track eingegangen. Diesmal will ich das eher aus der Sicht eines
Mathematikers tun.
Wenn ich eine Wandertour plane, prüfe ich im Vorfeld, ob ich
Tracks (GPX-Dateien) zu der geplanten Wandertour im Internet finden
kann.
Diese Tracks importiere ich dann in meine Routenplanungssoftware
BaseCamp. Dort schaue ich mir die Tracks an und überprüfe die
Qualität der Tracks.
Was überprüfe ich da genau?
Zur Klärung des Prüfvorgangs muss ich nochmal darauf eingehen, was sich
hinter dem Begriff "Track" eigentlich genau verbirgt. Das möchte ich
an einem "theoretischen" Beispiel, siehe nachfolgendes Bild 1,
erklären.

|
Bild 1: Track - Rund um einen See
|
Das Bild zeigt einen "kreisrunden" See, um den oberhalb eine
Straße (gelbe Linie) und unterhalb ein
Trampelpfad (gestrichelte blaue Linie) führt. Zusätzlich sind an dem
"See" Zahlen eingetragen, die an eine Uhr erinnern. Diese Zahlen spielen in
den weiteren Ausführungen eine wichtige Rolle und sollen die Orientierung
bei der Wandertour um den "See" erleichtern.
In den weiteren Erläuterungen will ich Tracks mit der Formel
Trk(P1,P2,...,Pn)
beschreiben. Das ist ein "theoretischer" Track bestehend aus n
Punkten.
Der Track
Trk(P1,P2,P3,P4)
besteht dann zB aus den 4 Punkten P1, P2, P3 und P4.
Für das Uhren-Beispiel bedeutet der Track
Trk(3,12,9),
dass der Wanderer von 3 Uhr (Startpunkt A), über 12 Uhr nach 9 Uhr
(Zielpunkt B), also über die Straße (gelbe Linie), um den See geht.
Tracks sind mathematisch gesehen Polygonzüge (Polylinien), die die Punkte
des Tracks, die Trackpunkte, mit einer geraden Linie verbinden.
Die soeben beschriebenen Formeln und Sachverhalte sind die
Vorraussetzungen für die nachfolgenden Betrachtungen.
Für die weiteren Erklärungen will ein Wanderer vom Startpunkt A,
also 3 Uhr, zum Zielpunkt B, also 9 Uhr, um den See gehen. Für diese
"theoretische" Wandertour besorgt er sich Tracks aus dem Internet. Tracks
aus dem Internet entstehen meistens durch Aufzeichnungen von gewanderten
Wegstrecken. Im Abstand von bestimmten Zeitintervallen merkt sich das
verwendete Navigationsgerät einen Punkt entsprechend dem eingestellten
Koordinatensystem.
Nehmen wir mal an, dass der Zeitintervall für den ersten Track 30 Minuten
beträgt. Der Track könnte dann so aussehen:
Trk(3,9)
Das ist der minimalste Track, der überhaupt möglich ist. Er besteht aus 2
Punkten und ist im Bild durch die rote Linie (=Luftlinie) zwischen
den Punkten A und B bzw. 3 Uhr und 9 Uhr bestimmt.
Dieser Track verdeutlicht sofort ein erstes Problem, was mit
"schlechten" Tracks verbunden ist.
Aus dem Track ist nicht ersichtlich, wo der Wanderer entlang gegangen
ist.
Ist er über die Straße (gelbe Linie über 12 Uhr) gegangen oder über den
Trampelpfad (blaue gestrichelte Linie über 6 Uhr). Der Track suggeriert,
dass er über den "See" gegangen ist. In Wirklichkeit muss er die Straße oder
den Trampelpfad genommen haben.
Der Track (rote Linie) ist auch wesentlich kürzer als die Straße (gelbe
Linie über 12 Uhr) oder der Trampelpfad (gestrichelte blaue Linie über 6
Uhr). Das ist ein zweites Problem, das mit "schlechten" Tracks
verbunden ist.
"Schlechte" Tracks suggerieren eine falsche Streckenlänge gegenüber der
tasächlichen Wegstrecke.
Jetzt besorgt sich der Wanderer einen anderen Track:
Trk(3,6,9)
Dieser Track besteht aus 3 Punkten und ist im Bild die
blaue durchgezogene Linie. Jetzt ist sofort klar, welchen Weg der
Wanderer genommen hat, nämlich über den Trampelpfad bei 6 Uhr. Auch die
Tracklänge nähert sich der tasächlichen Streckenlänge etwas an, erreicht
diese aber noch lange nicht.
Die nächsten Tracks, die der Wanderer ausprobiert, sind die Tracks
Trk(3,5,7,9) und
Trk(3,4,5,6,7,8,9).
Der letzte Track besteht schon aus 7 Punkten und ist im Bild die
grüne durchgezogene Linie. Dieser Track nähert sich schon sehr
deutlich dem Halbkreisbogen (=Trampelpfad) an, erreicht den Trampelpfad in
der Streckenlänge aber noch nicht, wie im Bild leicht zu sehen ist.
Jetzt kan man dieses Verfahren fortsetzen und immer mehr Trackpunkte
hinzunehmen. In der Praxis könnte man zB jede Minute einen Trackpunkt
aufzeichnen. Das Ergebnis wäre der Track
Trk(15=3 Uhr,16,17,18,...,29,30=6 Uhr,31,...,44,45=9 Uhr)
Dieser Track besteht aus 31 Punkten und kommt der tatsächlichen
Streckenlänge ziemlich nahe.
Die Track-Beispiele zeigen, je mehr Trackpunkte ein Track besitzt, desto
genauer gibt ein Track die tatsächliche Streckenlänge wieder.
Mathematisch gesehen wird die Länge eins Tracks nie die tatsächliche
Länge einer Route erreichen.
Dafür gibt es in der Mathematik den limes-Begriff
(limes=Grenzwert).
lim Track-Länge(P1,...,Pn) =
Routen-Länge
n ➞ ∝
Umgangssprachlich formuliert: Wenn die Anzahl der Trackpunkte
n gegen Unendlich geht, ist die Track-Länge über alle
Trackpunkte von P1,P2,...,Pn gleich der
Routen-Länge.
Route ist ein neuer Begriff, den ich hier kurz erläutern
will/muss.
Wanderer bewegen sich in der Regel auf begehbaren Wegen und gehen
nur in Notfällen "querfeldein". Routenplanungsprogramme kennen diese
"begehbaren" Wege, weil zu den "begehbaren" Wegen Zusatzinformationen
(Koordinaten, Name, Kommentare, Symbol, Höhe, Adresse, Wegeart usw)
vorhanden sind, die in digitalen routingfähigen Karten hinterlegt
sind. Mit diesen Zusatzinformationen können die Programme den genauen Weg, die
Route, bestimmen. In unserem "theoretischen" Beispiel ist die
Route die blaue gestrichelte Linie (=Trampelpfad) von 3 Uhr
über 6 Uhr nach 9 Uhr. Auch die genaue Länge der Route ist dem
Routenprogramm bekannt. Es ist die Länge des Kreisbogens der blauen
gestrichelten Linie.
Jetzt kommen wir wieder zur Ausgangsfrage zurück.
Ich plane meine Wandertouren auf Routen. Schließlich will ich ja auf
Wegen (Trampelpfade, Radwege, Straßen usw) gehen und nicht auf Luftlinien
(="querfeldein" durchs Gelände). Damit die Datenmenge bei der Übertragung
auf Navigationsgeräte überschaubar bleibt, wandle ich meine
Routen vor der Übertragung in Tracks um. Die so erstellten
Tracks bilden die tatsächlichen Routen sehr genau ab und
unterscheiden sich in der Länge erst ab der 2.Stelle nach dem Komma. Diese
Genauigkeit ist für eine Navigation mit den Tracks vollkommen
ausreichend.
Ich will es noch einmal ganz deutlich formulieren:
Ich übertrage nur Tracks auf meine Navigationsgeräte!
Ich könnte zusätzlich auch Routen auf meine Navigationsgeräte
übertragen. Aber die benötige ich nicht. Das wäre mehr als die doppelte Datenmenge.
Routen brauche ich nur zur genauen Planung auf meinem Computer.
Wenn ich mir nun Tracks aus dem Internet besorge und in mein
Routenplanungsprogramm importiere, gehe ich den umgekehrten Weg. Ich wandle
die Tracks in Routen um und prüfe deren Qualität. Dabei prüfe
ich, wo die so erstellten Routen entlangführen:
-verlaufen sie auf den gewünschten Wegen und
Straßen
-machen die erstellten Routen keine unnötigen
Umwege
-sind die Routen mit den Ausgangs-Tracks möglichst
deckungsgleich
Die meisten Tracks aus dem Internet besitzen zu wenige Trackpunkte und
führen zu den oben erwähnten Problemen (unklare Streckenführung). Bei
Routen, die aus solchen "schlechten" Tracks erstellt werden, ist oft viel
manuelle Nacharbeit erforderlich.
Meistens verwerfe ich nach einer ersten Sichtung (aus den zuvor
aufgeführten Gründen) die aus den Internet-Tracks generierten Routen und
plane manuell meine eigenen Routen. Dabei dienen mir die Internet-Tracks
allerdings als Vorlage, wo der geplante Wanderweg entlangführen
könnte.
Nach allen Beispiel-Tracks, auch dem Minimal-Track, dem 2-Punkte-Track,
kann ich navigieren. Ich muss mir nur mit Hilfe einer Karte überlegen, wie
ich vom Startpunkt A (3 Uhr) zum Zielpunkt B (9 Uhr) komme. Über die Straße
oder den Trampelpfad.
Im Gelände funktioniert das vielleicht noch ganz gut, weil es am
Entscheidungspunkt (zB Startpunkt A) nicht viele Alternativen (im
"theoretischen" Beispiel nur 2) gibt.
Problematisch werden solche "trackpunktarmen" Tracks zB bei der
Durchquerung von großen Ortschaften, wenn zusätzlich noch Wegmarkierungen
fehlen. Dann muss ich intensiv die Karten auf dem kleinen Bildschirm des
Navigationsgerätes studieren, um den richtigen Weg zu finden. Das ist
zeitaufwändig und nervenaufreibend.
Für mich sind das allerdings keine Probleme. Meine Tracks enthalten
genügend Trackpunkte, so dass ich Ortschaften "tiefenentspannt" auf den
richtigen "Tracks" (also Wegen und Straßen) durchqueren kann.
Meine Tracks, die ich in meinem Blog zum Download zur
Verfügung stelle, werden aus meinen eigenen Routen generiert und sind
zu 99% deckungsgleich mit den ursprünglichen Routen. Nutzer meiner Tracks
dürften diese Tracks ohne Probleme in sofort nutzbare eigene Routen
umwandeln können, ohne dass viel manuelle Nacharbeit erforderlich
wäre.
Das wünsche ich mir auch von den Internet-Tracks. Aber leider ist das nicht
oft der Fall.
Viele Wanderer stellen ihre aufgezeichneten Tracks einfach ins Internet.
Manchmal ist das einfach nur "Müll" und nicht zu gebrauchen. Theoretisch
müssten sich die Wanderer die aufgezeichneten Tracks in ihre eigenen
Routenplanungsprogramme laden und aus den aufgezeichneten Tracks passable
Routen erstellen. Diese so erstellten Routen müssten dann wiederum in Tracks
umgewandelt werden. Erst dann "dürften" diese "nachbearbeiteten" Tracks ins
Internet gestellt werden. Aber dieser soeben beschriebene Prozess der
Nachbearbeitung der aufgezeichneten Tracks ist teilweise mit enormen
Arbeitsaufwand verbunden, den viele Wanderer scheuen.
Mich ärgert das immer wieder, wenn ich solche nicht "nachbearbeiteten"
Tracks im Internet finde.
C5) Januar 2022: Software/Navigation - Mit
welcher Software plane ich Tracks und womit
navigiere
ich unterwegs?
Im Menüpunkt
Planung
(in der 2.Phase - Feinplanung) und hier im
Thema-C4 beschrieb
ich ziemlich genau, was ich unter Tracks verstehe und
wie ich meine Tracks unter der Verwendung von
Routen mit der Routenplanungssoftware
BaseCamp erstelle. Als Ergebnis dieses Prozesses
liegen dann Tracks vor. Das kann nur einer sein, wenn ich
auf Tageswanderungen oder Mehrtageswanderungen unterwegs
bin. Bei Langstreckenwanderungen über große Entfernungen
bevorzuge ich die Aufteilung der Gesamtstrecke in einzelne
Tagesetappen/Sections, wobei jede Tagesetappe/Section durch einen eigenen
Track repräsentiert wird. Die so erstellten Tracks sind von
der Länge fast identisch mit der Länge der Routen und bilden
die Routen daher sehr genau nach. Das geht nur, wenn die
Tracks möglichst viele Trackpunkte besitzen.
Manchmal mache ich mir die Mühe und erstelle zu den Tracks
noch wichtige Wegpunkte (POI). Speziell für
Wandertouren in Spanien auf den dortigen Jakobswegen
definiere ich so die Positionen von Herbergen, Pensionen,
Hotels und Supermärkten. Das erleichtert die Suche nach
diesen Örtlichkeiten am Ende eines langen und anstrengenden
Wandertages enorm.
Die Funktionalität des Routenplanungsprogramms
BaseCamp will ich hier nicht näher erläutern. Das
würde den Rahmen dieses Blogs sprengen. Vielmehr verweise
ich für Funktionsbeschreibungen auf das Internet und den
Hersteller Garmin.
Dieser erste Schritt der Planung der Routen und
Tracks mit dem Routenplanungsprogramm BaseCamp ist für
Langstreckenwanderungen unglaublich zeitaufwändig. Manchmal
sitze ich mehrere Wochen an der Planung für eine
Langstreckenwanderung.
Die Planung einer Wandertour gehört für mich zur Wandertour
dazu. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Die sehr gute
Vorbereitung einer Wandertour verschafft mir auf der
Wandertour unglaublich viele Freiheitsgrade. Ich kann die
Wandertour in vollen Zügen genießen und muss mich um fast
nichts kümmern.
Die Planungsergebnisse, wie Tracks und
Wegpunkte (wenn vorhanden), exportiere ich
nun in eine GPX-Datei und lege
diese vorerst auf meinem Computer
ab.
In einem zweiten Schritt übertrage ich die GPX-Datei
auf mein Navigationsgerät.
Die ersten Jahre war mein Navigationsgerät ein
Garmin GPSMap 64st. Das Gerät versah einige Jahre
zuverlässig seinen Dienst. Aber der relativ kleine
Bildschirm hat mich immer gestört. Zu dieser Zeit hatte ich
drei technische Geräte für unterschiedliche Aufgaben
(Navigation, Fotografie und Telefonie) in meiner Packliste.
Weil ich mich in den letzten Jahren immer mehr mit dem
Ultraleicht-Gedanken beschäftigte, standen irgendwann auch
die drei Geräte zur Disposition. Ein Smartphone kann
die drei genannten Aufgaben ebenfalls sehr gut lösen. Ab
einem gewissen Zeitpunkt (Jahr 2019) war ich also nur
noch mit dem Smartphone (Apple iPhone SE)
unterwegs.
Mit einem Smartphone kann ich problemlos
telefonieren und fotografieren.
Aber wie sieht es mit der Navigation aus?
In den letzten Jahren testete ich daher eine ganze Reihe
von Apps für die Navigation auf dem
Smartphone. Darunter waren die Apps
-mapy.cz
-Gaia GPS
-Komoot
-OsmAndMap
-Outdooractive
-usw.
Die Liste der getesteten Apps ist noch viel länger, aber
das sind die wichtigsten und bekanntesten Apps. Viele Apps
kenne ich nicht mehr namentlich, weil ich sie schon von
meinem Smartphone löschte.
Bevor ich hier anfange und die Vor- und Nachteile der
genannten Apps aufzähle, beschreibe ich lieber, welche
Funktionalitäten eine gute App besitzen muss, wenn sie nicht
durch mein Auswahlraster fallen soll.
Hinweis: Wenn ich in den folgenden Ausführungen eine App namentlich nenne und über die Probleme rede, die ich mit der App hatte, bezieht sich das immer auf den Testzeitpunkt. Habe ich eine App erstmal "aussortiert", hat es die App schwer wieder in meinen Fokus zu rücken, selbst wenn das genannte Problem mittlerweile behoben sein sollte.
Folgende Funktionalitäten wären wünschenswert:
(1) einfache und intuitive
Benutzerführung
(2) beliebige und
tiefe Ordnerstrukturen
(3) Import von
GPX-Dateien (Tracks)
(4) Sortierung von Tracks
und Wegpunkten
(5) Nutzung/Qualität
von Offline-Karten
(6) Anzeige einer
Position in
unterschiedlichen
Koordinaten
(7)
regelmäßiger Update-Service der App und
der Karten
(8) Erstellung
beliebiger Wegpunkte
(9) Hilfefunktion (App
und Internet)
(10) Support bei Problemen mit der App
Wenn ich eine App auf ihre (1)
einfache und intuitive Benutzerführung teste, tippe
ich erstmal auf der Oberfläche der App herum. So prüfe ich,
wie schnell ich bestimmte Funktionen erreichen kann.
Gleichzeitig schaue ich überall mal rein, ob die
aufgerufenen Funktionen selbsterklärend sind. Ich spiele
sozusagen mit der App, ohne ein bestimmtes Ziel oder
Ergebnis erreichen zu wollen. Dabei überprüfe ich so im
Vorbeigehen, ob wichtige Funktionen (Kartenauswahl, Ordner,
Import von Tracks usw) vorhanden und einfach zugänglich
sind. Ein Programmabsturz wäre der Super-Gau und das Aus für
die App.
Übersteht eine App den ersten "Schnelltest", geht es
weiter. Die App Gaia GPS hat zB den ersten Test nicht
überstanden, weil sie für meine Begriffe nicht einfach und
intuitiv bedient werden kann. Sie ist funktionell zu
"überfrachtet".
Als ehemaliger Softwareentwickler war ich es gewohnt in
einer stark strukturierten Umgebung zu arbeiten. Angefangen
von Datei-Ordnern bis zur Namensvergabe war alles so
eindeutig geregelt, dass viele hundert Entwickler an einem
Projekt arbeiten konnten, ohne dass sie sich gegenseitig in
irgendeiner Weise behinderten. Diese Vorgehensweise
bevorzuge ich auch bei meinen Wandertouren, speziell den
Tracks. Ich möchte meine Tracks, Stand
Januar 2022 sind das ca. 1500 Stück, in teilweise
tiefen Ordnerstrukturen ablegen. Apps, die keine
(2) beliebigen und tiefen Ordnerstrukturen erstellen
können, scheiden gnadenlos aus dem Kreis der App-Bewerber
aus. Ich bräuchte zwar keine speziellen Ordner, weil ich ein
ziemlich ausgeklügeltes Namenssystem für meine Tracks (siehe
Menüpunkt
Planung, 2.Phase - Feinplanung, Punkt 7) besitze, aber aus Gründen
der Übersichtlichkeit bevorzuge ich eindeutig Ordner für die
Tracks (siehe Bild 1).

|
Bild 1: Oberste Ordnerstruktur für meine Tracks
|
Ganz wichtig ist für mich auch ein
(3) Import von GPX-Dateien (Tracks).

|
Bild 2: Import von Tracks
|
Apps, die eigene Tracks nicht importieren können (siehe Bild 2), fallen daher gnadenlos aus meinem Raster. Die App
mapy.cz ist eine sehr schöne App, die viele regionale
und überregionale Wanderwege in die App integriert hat. Aber
sie kann keine tiefen Ordnerstrukturen anlegen und kann auch
keine eigenen Tracks importieren. Das ist sehr schade, weil
die App optisch einen sehr ansprechenden und aufgeräumten
Eindruck macht. Für bekannte Wanderwege (zb Rennsteig im
Thüringer Wald), die in der App vorhanden sind, ist die App
aber eine eindeutige Empfehlung.
Ganz wichtig ist auch die
(4) Sortierung von Tracks und Wegpunkten nach frei
wählbaren Sortierkriterien (zB Name, Datum usw). Das
erleichtert die Suche in den teilweise tiefen
Ordnerstrukturen enorm. Die App Komoot hat bei meinem
letzten Test eine eingestellte Sortierung bei einem erneuten
Start der App nicht beibehalten. Das ist ein No-Go.
Ein weiterer Aspekt einer "guten" Navi-App ist die
(5) Nutzung von Offline-Karten. Speicherplatz ist
heutzutage kein Problem mehr. Ganz weit vorne sind Apps, die
nur die Gebiete (Kacheln, siehe Bild 3)
herunterladen, die für die aktuelle Wandertour benötigt
werden. Das spart doch etwas Speicherplatz.
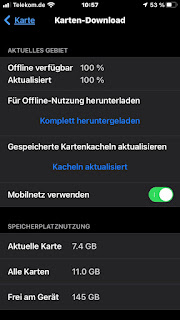
|
Bild 3: Karten und Kacheln für Offline-Betrieb
laden
|
Ich lade vor einer Wandertour alle Karten herunter,
die für einen Offline-Betrieb der Navi-App erforderlich
sind. Das mache ich zuhause im WLAN-Betrieb. Unterwegs tue
ich das nicht.
Auch die (5)
Qualität von Offline-Karten (Maßstab,
Detailgenauigkeit usw) ist von entscheidender Bedeutung.
Wenn ich eine neue Navi-App auf die Karten-Qualität teste,
schaue ich mir immer sehr genau meine Wohngegend an. Dort
gibt es Trampelpfade, die auf manchen Navi-Apps nicht zu
finden sind. In der OSM-Karte im Internet sind die
Trampelpfade zu sehen, in der zu testenden Navi-App fehlen
sie aber. Ich frage mich dann immer, warum diese
Trampelpfade in einer Wander-App fehlen. Das sind ja genau
die Wege, die ein Wanderer evtl. auf seinen Touren gehen
will. Ich stelle mir dann vor, wie das in einem unbekannten
Gebiet wäre, wenn Wege einfach nicht angezeigt würden.
Solche Navi-Apps lege ich sofort zur Seite.
Der letzte wichtige Punkt ist die
(6) Anzeige einer Position in unterschiedlichen
Koordinaten
(siehe Bild 4). Das ist besonders für Hilfs- und
Rettungsaktionen unbedingt erforderlich.

|
Bild 4: Eine Position in unterschiedlichen
Koordinaten
|
Die soeben beschriebenen Punkte (1) bis (6) sind
Anforderungen, die ich an jede Navi-App stelle. Diese
Anforderungen müssen unbedingt erfüllt sein. Wenn nicht,
fällt die Navi-App durch mein Prüf-Verfahren.
Die Punkte (7) bis (10) sind wünschenswerte Anforderungen,
aber nicht zwingend erforderlich.
Der geneigte Leser wird sich fragen, welche Navi-App ich
aktuell verwende.
Die Bilder 1 - 4 stammen von der Navi-App
Topo GPS, die ich schon seit einigen Jahren verwende. Auch bei
dieser App gibt es das eine oder andere Problem, wo ich mir
eine Verbesserung wünschen würde. Aber das sind meistens
optische Verbesserungen.
Die von mir geforderten Hauptfunktionen (1) bis (6) werden
von Topo GPS zu meiner vollen Zufriedenheit erfüllt.
Und auch die Funktionen (7) bis (10) werden von
Topo GPS realisiert.

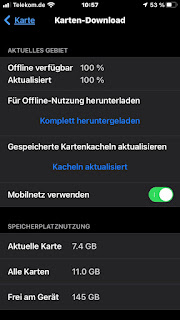




Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen